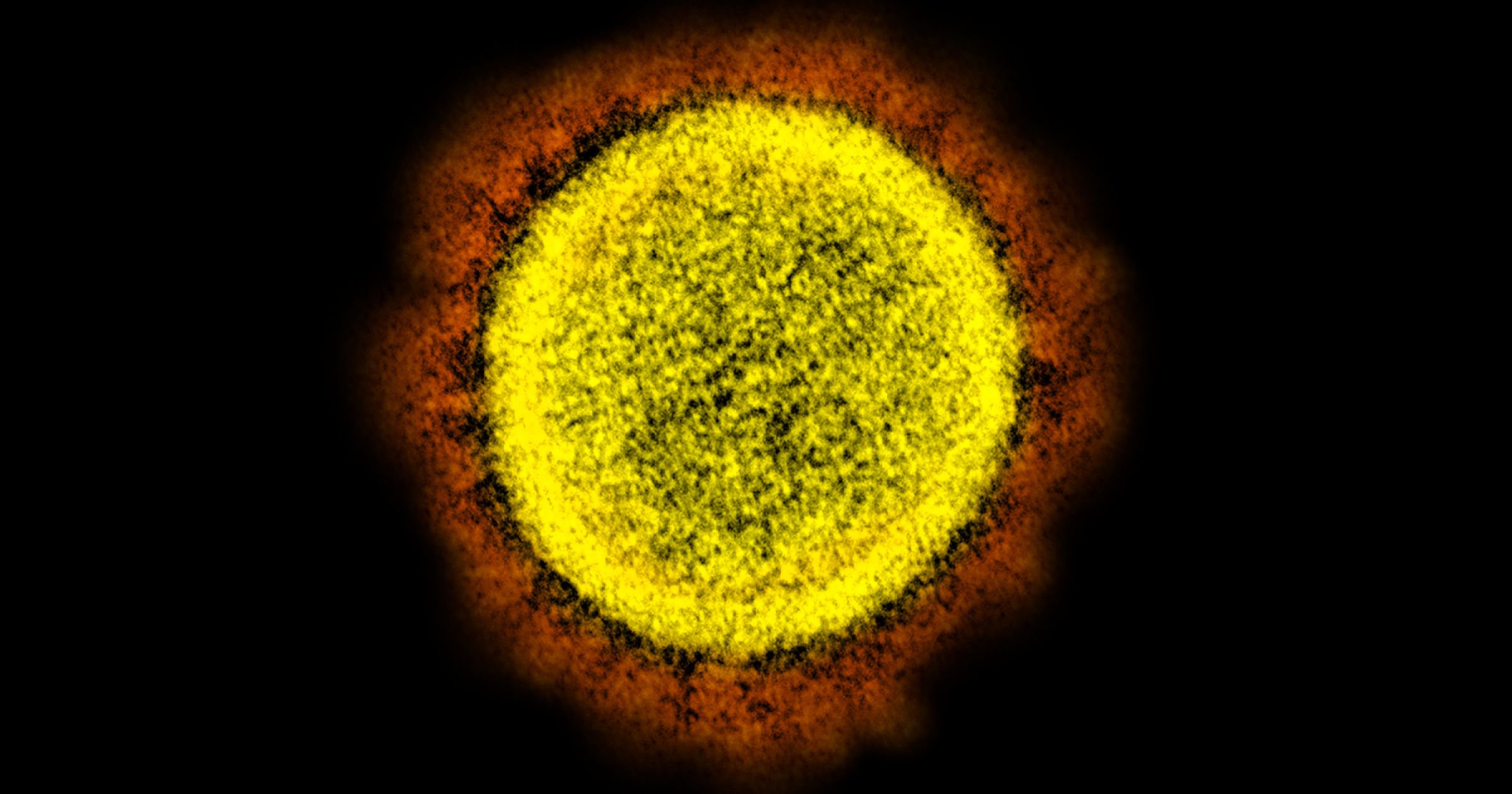Ein pfingstlicher Essay von Kurt Schanné
An Pfingsten rufen Christen den Heiligen Geist an, er möge doch, wie damals auf die Jünger, so auch auf sie herabkommen und sie beleben. In der Liturgie und in den wunderbaren pfingstlichen Gesängen – allen voran in der Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“ – ist die Sehnsucht nach Belebung nach Händen zu greifen. Immerhin war diese Sehnsucht auch in alten Zeiten den Christen bereits so wichtig, dass unter den vielen Eigenschaften des Heiligen Geistes gerade das „vivificare“, das „Beleben“, prominenten Eingang in das christliche Glaubensbekenntnis gefunden hat.Ein wesentlicher Aspekt im belebenden Wirken des Heiligen Geistes ist die „Inspiration“. Schon dem Wortsinn nach geht es hier darum, dass der Heilige Geist in einen Menschen eindringt und dort sein Leben entfaltet. Eigenartiger Weise wurde der Begriff der Inspiration in der Christentumsgeschichte auf einen sehr spezifischen theologischen Sachverhalt eingeengt. Einige besonders wichtige Schriften aus den Anfängen des Christentums, die Evangelientexte, die Apostelgeschichte und die Briefe des Paulus und des Johannes werden als „inspiriert“ bezeichnet. Will nach klassischer Definition sagen: sie wurden unter Mitwirkung und Eingebung des Heiligen Geistes verfasst. Eben deshalb sind sie „Heilige Schriften“. Später dann wurde die „Inspiration“ auch auf die Schriften des Judentums ausgedehnt, die in den christlichen „Kanon“ übernommen wurden. Sie wurden gleichsam „rückwirkend“ für „inspiriert“ erklärt.Dass das Phänomen der „Inspiration“ erheblich weiter reicht, geriet dabei etwas in Vergessenheit. Die folgenden Überlegungen wollen daran erinnern, dass auch die Wissenschaft in einem gewissen Sinn „inspiriert“ genannt werden kann. Dabei werde ich insbesondere auf einige Charakteristika des biblischen Pfingstereignisses eingehen und Analogien dieses „Geistereignisses“ zum Phänomen Wissenschaft herausarbeiten.Zunächst jedoch – im Sinne von Präliminarien – möchte ich mich auf „Spurensuche“ begeben. Dabei geht es mir darum, stichwortartig herauszufinden, wo in der überlieferten Theologie die Wissenschaft zum Thema wird. Damit ist dann der Boden bereitet für die angezielte These.
1. Bisherige theologische Verortungen von Wissenschaft
(1) Eine besonders breite Spur durch die gesamte Theologiegeschichte ist die Auseinandersetzung des christlichen Glaubens und seiner methodisch verantworteten Auslegung – der Theologie – mit dem jeweils aktuellen Wissen. Sie reicht bis in die Anfänge des Christentums zurück. Bereits Paulus betrachtet die Wissenschaft seiner Zeit als „Weltweisheit“, der er die „Torheit des Kreuzes“ gegenüberstellt (1 Kor 1, 18 f. 23 f.) . Mit dieser „Weltweisheit“ meint Paulus die – zu dieser Zeit bereits sehr eklektische – hellenistische Philosophie, ein „mixtum compositum“ seriöser wissenschaftlicher Theorien und ins Grundsätzliche reichender Reflexionen. Gerade im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung haben sich im mediterranen Raum eine ganze Reihe Gelehrten vor allem in den akademischen Hochburgen Alexandria und Athen der Wissenschaft und der Philosophie verschrieben. Umfassende Werke vornehmlich aristotelischer Prägung umfassen unter dem Begriff „Physik“ das gesamte damalige Naturwissen. Aber auch in in Bereichen wie Logik, Mathematik, Astronomie und Medizin sind beachtliche Erkenntnisse zu verzeichnen, nicht zu vergessen die Medizin. Aufgrund des Brands der Bibliothek von Alexandria ist nur der geringste Teil dieser Werke erhalten. Aber in den überlieferten Werken etwa eines Plutarch, Ptolemaios, später auch Galenos erkennen wir einen Nachklang der geistigen Kreativität dieser Zeit. Von all dem dürfte Paulus als gelernter Zeltmacher kaum Kenntnis gehabt haben. Mehr vielleicht schon von den populären Varianten der stoischen Philosophie, die sich in Anlehnung an Denker wie Seneca intensiv auch mit Fragen der Ethik und der Religion befassten. Sicher auch von den religiösen Strömungen seiner Zeit, unter denen die Mysterienkulte und verschiedene Varianten der Gnosis besonders herausragten. Letzten Endes interessierte Paulus aber spätestens seit Damaskus nur das Eine: den Menschen eine Wahrheit zu verkünden, die den damaligen wissenschaftl. und weltanschaul. „mainstream“ und auch die auf Selbsterlöung orientierte Gnosis radikal durchkreuzt. Kern dieser nur im Glauben zugänglichen Wahrheit ist – modern gesprochen – die Annahme des Menschen durch Gott vor aller Leistung.
Der Antike war ein solcher Gedanke ungeläufig, ja er erschien den meisten schlicht absurd. Folgten doch die antiken Weisen dem Modell der Selbstvervollkommnung aus eigener Kraft (oikeiosis). Dass das Entscheidende des menschlichen Lebens „ab extra“ kommen sollte, konnten sie nicht begreifen. Diese Wahrheit, dass der Mensch im Tiefsten alleine aus der Gnade Gottes lebt, hatte Paulus ab einem bestimmten Moment seines Lebens ergriffen, und sie lies ihn nicht mehr los. Er musste einfach darüber sprechen. Darüber sprechen – und ich mache jetzt einen sehr gewagten Sprung – müssen natürlich auch die Päpste. Benedikt der XVI. hat in seiner Enzyklika zunächst andere Akzente gesetzt, obwohl das von ihm in der Enzyklika „Deus Caritas est“ beschriebene Verhältnis zwischen antikem Eros und christlicher Agape durchaus eine hohe Analogie zum Verhältnis zwischen Weltwissen und christlichem Glauben aufweist. Sein Vorgänger hat in seinem langen Pontifikat imme wieder betont, dass nur die uns geschenkte göttliche Wahrheit wirklich entscheidend ist. Zwar schätzte Johannes Paul II. als ehemaliger Professor der Philosophie auch die „weltliche Erkenntnis“ und damit auch Wissenschaft und vor allem die Philosophie hoch ein. Letztlich aber handelt es sich nach seiner Auffassung bei diesen Disziplinen nur um Vorstufen der „Fülle der Wahrheit“. Diese Fülle zu erfassen und damit eine besonders tiefe Einsicht in das Wesen des Menschen und das Schicksal der Welt zu gewinnen, bleibt dem sich im Glauben der Gnade Gottes öffnenden Menschen vorbehalten. Glaube setzt Vernunft, Theologie setzt Wissenschaft voraus, überschreitet sie aber in entscheidender Weise, ohne mit ihr in Widerspruch zu geraten. So nachzulesen in der päpstlichen Enzyklika „Fides et ratio“ aus dem Jahr 1998. Zwar ist die heutige Wissenschaft erheblich umfassender und ausdifferenzierter als sich das die begabtesten Theologen und auch Wissenschaftler selbst überhaupt vorstellen.
Dieses „Weltwissen“ hat seine nicht mehr bestreitbare und im Zweiten Vaticanum, (Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes, Art. 36) auch eingeräumte Bedeutung in sich selbst, weshalb sich der Vatikan immerhin mittlerweile von einer „Päpstliche Akademie der Wissenschaften“ beraten lässt. In Hinsicht auf das „Glaubenswissen“ hat es aber nicht mehr als die seit Thomas von Aquin bekannte „Dienstmagd-Funktion“ und wird dementsprechend „integriert“. Ob die „weltlichen Wissenschaften“ und deren säkulare Gesamtreflexion, die Philosophie, selbst diese Funktion akzeptieren und die Integration befürworten, ist dabei für die Theologie unerheblich. Nach wie vor gilt in dieser Hinsicht das Wort des bereits erwähnten Apostels Paulus: Der geistliche Mensch beurteilt alles, wird aber von niemandem beurteilt (…).
Der erste theologische Ort, an dem die Wissenschaft zum Thema wird, ist somit das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Dieses wurde im Laufe der christlichen Geschichte verschieden interpretiert. Die kath. Theologie hat für dieses Gebiet im 19. Jahrhundert den bildhaften Begriff der „praeambula fidei“ gefunden. In der neueren Zeit hat sich für die „Vorhöfe der Theologie“ die Bezeichnung Fundamentaltheologie eingebürgert. In jedem Fall wird davon ausgegangen, dass es möglich ist, das Verhältnis von Glaube und Vernunft selbst mit Mitteln der Vernunft auszuloten. Die Spanne entsprechender Versuche reichte von scharfer, fast kontradikorischer Entgegensetzung auf der Linie von Paulus bis hin zu Modellen der Konvergenz.
Auf jeden Fall aber erfolgt die Auseinandersetzung zwischen Glaube und Vernunft bis in die jüngste Zeit theologischerseits im Modus der abgrenzenden Unterscheidung … anders einige Philosophen/s. Lutz-Bachmann … An der „Front“ dieser Auseinandersetzung ist mittlerweile eine gewisse Ruhe eingetreten. Diese ist erkauft durch die bereits oben angedeutete fein säuberliche Abgrenzung des jeweiligen „Reviers“. Während der Glaube auf das Heil des Menschen ziele und eine grundlegende Sinndimension des menschlichen Daseins auch über sein zeitliches Ende hinaus eröffne, habe die Wissenschaft zunächst die sachlich korrekte Beschreibung und Erklärung/Deutung der begegnenden Wirklichkeit im Sinn. Besonders erfolgreich, so wird eingeräumt, sei dabei die Naturwissenschaft. Sie könne zudem in Form der Technik das menschliche Leben wesentlich erleichtern. Mit dem Sinn des Daseins aber hätten weder Wissenschaft noch Technik unmittelbar irgendetwas zu tun. Auch Handlungsorientierung lasse sich ihnen nicht unmittelbar entnehmen. Das gelte auch für die akademische Philosophie als Metareflexion. Umgekehrt erhebe die Religion heute keine innerweltlichen Wahrheitsansprüche mehr, sondern habe gelernt, sich jedenfalls in ihrem Kernbereich auf ihr Terrain zu beschränken: so der allgemeine Tenor. Es bleibt abzuwarten, wie lange dieser intellektuelle „Waffenstillstand“ anhält. Dass hier nach wie vor Sprengstoff liegt, zeigen etwa Themen wie Inkarnation, Wandlung, Wunder, Auferstehung, Jungfrauengeburt u.ä. Kurzum: Überall dort, wo Göttliches und Weltliches direkt zu interagieren scheinen, stellen sich für den heutigen Menschen meist unüberwindliche Probleme der Glaubwürdigkeit. Theologen, die diese Themen offensiv anfassen, werden auch heute noch in der katholischen Kirche inkriminiert. Dies allein zeigt, dass das Verhältnis von Glaube und Vernunft problematisch bleibt.
(2) Der zweite „locus theologicus“, an dem Wissenschaft zum Gegenstand wird, ist die Lehre von der Schöpfung und von der Stellung des Menschen in der Schöpfung, womit wir gegenüber der bisher diskutierten Fundamentaltheologie bereits den Boden der Systematischen Theologie betreten. Nach den Worten der Genesis schafft Gott die Welt aus dem Wort. Der neue Papst hat in seinem epochemachenden Werk „Einführung ins Christentum“ eine tiefsinnige Auslegung der hier anhebenden Logos-Theologie gegeben. Nach seiner Auffassung wäre die Welt gar nicht erkennbar, wäre ihr nicht schon immer der Logos als Strukturprinzip eingestiftet. Dieses Erkennen ist die Voraussetzung aller Gestaltung und Bewahrung. In Gen 2, 19-20 heißt es: „Er (Gott) formte aus Erde die Landtiere und die Vögel. Dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde; denn so sollten sie heißen. Der Mensch gab dem Vieh, den wilden Tieren und den Vögeln ihre Namen.“ Diese Stelle belegt, dass es der Mensch ist, der den Tieren Namen gibt. Dabei ist mit Sicherheit nicht gemeint, dass der Mensch jedem einzelnen Tier einen Eigennamen gibt. Vielmehr findet er Begriffe für die verschiedenen Arten. Mit diesen Begriffen und ihrer Verknüpfung ist auch der Anfang der Erkenntnis gesetzt. Aufschlussreich ist ferner, dass Gott es dem Menschen überlässt, die Tiere zu benennen. Die Tiere haben nicht schon von Gott her einen Namen. Vielmehr ist der Mensch es, der die Namen findet und Gott scheint damit zufrieden zu sein. Die von Ratzinger favorisierte Logos-Theologie, die geistige Konstruktion eines christlich assimilierten Platonismus und der damit einhergehenden Universalienlehre, wird an dieser Stelle gleichsam geerdet.
Offensichtlich entsteht Wissen in einer Art Interaktion zwischen göttlicher Vorgabe und menschlicher Aktivität. Objektiver und subjektiver Geist müssen“ kommunzieren“. Nur so entsteht Erkenntnis. Der zu sich selbst erwachende Mensch findet somit zur Erkenntnis, indem er die Dinge benennt und die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen ihnen erforscht. Das Vermögen dazu ist ihm natürlicherweise gegeben, ebenso wie das Vermögen der Gestaltung. Wissenschaft und Technik sind also von ihren ersten Anfängen her selbstverständl. Teil der Ausstattung des Menschen. Dass diese Erkenntnis von anderen Traditionen überlagert, ja teilweise verschüttet wurde, gehört zu den bedauerlichen Entwicklungen der Christentumsgeschichte. Offensichtlich musste das Natürliche in gewisser Weise entwertet werden, um dem Übernatürlichen Platz zu machen.
Bereits die Interpreten der biblischen Schriften weisen auf den Baum der Erkenntnis von gut und böse hin und auf die Schlange, die den Menschen verführt, davon zu essen. Sie werden ebenfalls nicht müde, den Turmbau zu Babel als ein Menetekel für die Hybris der Technik anzusehen. Offensichtlich interessieren weniger die positiven Fähigkeiten des Menschen als vielmehr seine Anfälligkeit für das Übertreten des göttlichen Gebots. Daraus macht die christl. Theologie späterhin eine Sündenlehre, die sich den Texten so überhaupt nicht entnehmen lässt und die den freieren Geistern schon immer den Geschmack am Christlichen gründlich verleidet hat. Dass diese „Urgeschichten“ neben der zweifellos vorhandenen Problematik der Übertretung des göttlichen Gebots ganz wesentlich auch Ätiologien sind, also Versuche, vorgefundene menschl. Eigenschaften und Widerfahrnisse zu deuten, gerät dabei aus dem Blick. Eine die spätere Wirkungsgeschichte zunächst beiseite lassende Deutung zeigt aber, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis von gut und böse essen musste und dass die Dramatik der Geschichte geradezu darauf angelegt ist. Erst durch Erkenntnis von gut und böse wird er überhaupt Mensch. Das mit seinem Mensch-Sein einsetzende Nachdenken, die Reflexion auf sich selbst, führt natürlich zwangsläufig zu Phänomenen wie sexuelle Scham, Schmerz, Tod und zur bewussten Wahrnehmung der Unbilden der äußeren Natur, der nur mit Arbeit beizukommen ist. Damit ist dann der Raum des Paradieses endgültig verlassen. Der Mensch ist auf dem Boden der Realitäten angekommen. Zugleich aber heißt es: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, und alles Wissen steht ihm offen (Gen 3, 22-23). Gut so.
Nur ein Unterschied bleibt zwischen Gott und Mensch. Der Mensch soll den Ackerboden bebauen, aus dem er gemacht ist und zu dem er zurückkehrt. Das ewige Leben, die Frucht des ersten Baumes des Paradieses, bleibt ihm versagt. Will heißen: der einzige Unterschied zwischen Gott und Mensch ist und bleibt die Un-/Sterblichkeit, keineswegs jedoch die Unfähigkeit zur Erkenntnis. Den bibl. Texten lässt sich somit unmittelbar keineswegs eine Invektive gegen Wissenschaft und Technik entnehmen. Vielmehr handelt es sich bei der Erkenntnis um eine natürliche Begabung des Menschen, die sowohl die theoretische Dimension (wahr/falsch) als auch die praktische Dimension (gut/böse) einschließt. Dass dieses Wissen und das darauf fußende Können immer endlich und damit fehlbar bleiben, ist klar. Auch ist nicht auszuschließen, dass sich in diese Bereiche Motive einschleichen können, die letztlich gegen den Menschen wirken. Aber der Mensch – und das ist die Essenz der Schöpfungstheologie – ist dazu da, seine Vernunftpotentiale ausschöpfen, Erkenntnisse gewinnen und nach diesen Erkenntnissen die Welt lebbar gestalten.
(3) Neben Fundamentaltheologie und Schöpfungslehre ist ein weiterer klassischer „locus“, an dem Wissenschaft zum Thema wird, die Ethik oder Moraltheologie. In dieser Hinsicht interessant ist bspw. der 2. Band des Katholischen Erwachsenenkatechismus unter dem Titel „Leben aus dem Glauben“ (Freiburg 1995), der im Wesentlichen auf den emeritierten Erfurter Moraltheologen Wilhelm Ernst zurückgeht. Dort wird die Wissenschaft hauptsächlich unter dem 8. Gebot thematisiert. Die Weisung „Du sollst kein falsch Zeugnis geben wider deinen Nächsten“ bezieht sich zwar zunächst auf den zwischenmenschlichen Bereich. Immerhin aber widmet der Autor einen Abschnitt auch dem Thema „Wahrheit in der Öffenlichkeit“ (S. 453 f.) und kommt dort in einem Punkt auf den „Dienst an der Wahrheit in Wissenschaft und Technik“ zu sprechen. Nach positiven Bemerkungen zum Grundrecht der Freiheit der Wissenschaft gelangt er zu Grenzziehungen hinsichtlich der Methoden, Ziele und Folgen wissenschaftlichen Arbeitens. Die Methoden dürfen ihrerseits nicht inhuman sein. Ziel jedenfalls der handlungsorientierten Forschung muss der Mensch und seine Lebenswelt sein. Hinsichtlich der Folgen sieht der Autor eine Grenze dort, wo die Zerstörung der Lebensgrundlagen heutiger und künftiger Generationen droht und gelangt zu der Feststellung: „Wissenschaft ist nur dann ‚wahre’ Wissenschaft, wenn die Verantwortlichen die absehbaren Folgen ihres Handelns kritisch prüfen.“
Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung der Wissenschaft entsteht bei der Lektüre der Eindruck, dass der Autor die Wissenschaft im Wesentlichen unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung thematisiert und damit am eigentlichen Thema des achten Gebots vorbeischreibt. Das interne Wahrheitsethos der Wissenschaft, das nach Konrad Ott (Ipso facto. Zur ethischen Begründung normativer Implikate wissenschaftlicher Praxis, Ffm 1997) darin besteht, „nicht zu lügen, nicht zu betrügen, nicht zu fälschen, nicht zu manipulieren und keine fremden Ergebnisse als die eigenen auszugeben“ (346), scheint ihn dagegen erstaunlicher Weise nicht zu interessieren. Der Eindruck verdichtet sich, wenn man sich die anderen Stellen anschaut, an denen er auf Wissenschaft zu sprechen kommt. Vor allem das fünfte Gebot („Du sollst nicht töten“) dient als Einstieg der skeptischen Thematisierung der Genforschung und bietet Raum für ausführliche Erörterungen der „Verantwortung für die Schöpfung“. Unter dem sechsten Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“ werden wissenschaftlich fundierte Reproduktionstechnologien zum Gegenstand der kritischen Betrachtung. Extrakorporale Befruchtung außerhalb des „ehelichen Akts“ versieht der Autor mit schweren Bedenken. Was das und die ebenfalls inkriminierte „operative Sterilisation“ – z.B. bei verheirateten Paaren – mit Ehebruch zu tun haben soll, leuchtet jedoch auch bei tieferem Nachdenken nicht ein. Kurz vor dem bereits referierten achten Gebot erscheint die Forderung, geistiges Eigentum zu achten.
Hier ist die Subsumtion unter das siebte Gebot „Du sollst nicht stehlen“ korrekt und der sachliche Zusammenhang liegt auf der Hand. Diebstahl geistigen Eigentums, und damit auch Diebstahl wissenschaftlicher Erkenntnis, ist gerade im Zeitalter des mächtig anhebenden „electronic publishing“ ein ernstes Thema.Selbstverständlich ist die Ethik oder die Moraltheologie nicht der systematische Ort, um in unbedachter Weise positive Stimmung für Wissenschaft zu machen. Dazu sind die durch Wissenschaft und Technik mit ausgelösten Probleme zu drängend und nicht selten dilemmatisch. Man denke etwa an die aktuelle Diskussion über die Forschung an embryonalen Stammzelllinien. Gleichwohl spürt man eine deutliche Distanz zu wissenschaftlichen Entwicklungen. Wissenschaft wird insgesamt eher als Gefahr begriffen, denn als Chance. An diesem Punkt konvergieren leider allzu viele fundamentaltheologische, schöpfungstheologische und moraltheologische Überlegungen. Auf den Punkt gebracht: Wissenschaft gefährdet den traditionellen Glauben und zunehmend auch den Menschen und seine soziale sowie natürliche Umwelt. Daher muss sie in ihre Schranken verwiesen werden. Dass Wissenschaft hingegen selbst eine pfleglich zu behandelnde „spirituelle Grundlage“ hat und ohne diesen „geistigen Urquell“ gar nicht lebensfähig ist, wird schnell übersehen. Dies führt dann in der öffentlichen Debatte zu einer Fülle von Verzerrungen und Missverständnissen.
2. Ist Wissenschaft „spirituell“?
Kommen wir nun von diesen kritischen Präliminarien zum Fokus der hiesigen Überlegungen. M.E. besteht zwischen der biblischen Überlieferung des Pfingstereignisses, in deren Mittelpunkt ja die „Herabkunft“ des Geistes steht, und den Erfahrungen vieler Wissenschaftler hinsichtlich des Zustandekommens ihrer Erkenntnisses eine strukturelle Analogie. Selbstverständlich geht es an Pfingsten um den Heiligen Geist und damit um die zentrale Erkenntnis der jungen christlichen Gemeinde, dass der Geist Jesu noch immer und wieder unter ihnen präsent ist und sie berufen sind, ihn gleichsam wie eine Fackel in der Geschichte weiterzutragen. Dieser Geist Jesu, zugleich der Hl. Geist, wird korreliert mit Wahrheit, Licht, Liebe, Frieden. Kurzum: er (be)trifft doch mehr das Herz, nicht in erster Linie den Verstand. Auf der anderen Seite ist selbstverständlich auch der „Geist der Wissenschaft“ auf Wahrheit und auf Verständigung gerichtet, auf Kommunikation. Daher erscheint es eben nicht klug, die Phänomene vorschnell auseinanderzudividieren.
Sehen wir näher zu:„Am Pfingsttag waren alle zusammen an einem Ort“, heißt es in der Apostelgeschichte. Hier liegt m.E. der erste Vergleichspunkt. Ebenso wie Glaube bedarf auch Wissenschaft der Gemeinschaft. Wissenschaft ist kein singuläres Unternehmen in „Einsamkeit und Freiheit“ und war es nie. Sie ereignet sich immer in Gemeinschaft und
im Dialog, selbst dann, wenn dieser Dialog im wissenschaftlichen Individuum nur fingiert wird. Wissenschaft ist ein kommunikatives Geschehen, eingebettet in einen umfassenden, von der Lebenswelt ausgehenden und notwendigerweise in sie mündenden Dialog. So gesehen, ist die „Verantwortung des Wissenschaftlers“ zunächst vor allem seine ständige Bereitschaft, in der „community“ und gegenüber der Öffentlichkeit Antwort, und das heißt Rechenschaft zu geben und sich durch „Gegenreden“ immer wieder in Frage stellen zu lassen.„Da erhob sich plötzlich ein Brausen“ – Aus vielen Biographien spirituell, aber auch künsterisch und wissenschaftlich begabter Menschen wissen wir, dass die Erkenntnis wesentlicher Dinge plötzlich über sie kam. Zwar hatten sie sich lange zuvor damit herum getragen, bisweilen auch gequält. Aber dann geschah es doch ganz plötzlich, dass sie das Neue, noch nie da Gewesene erfassten und zur Darstellung brachten. Damit meine ich nicht, dass viele Erkenntnisse, auch fundamentaler Art wie z.B. die Atomspaltung, sich eher zufällig ergeben. Ich meine die Plötzlichkeit, anders: die historische Unableitbarkeit, mit der etwas Neues vor Augen steht. Hier wäre – entgegen dem technokratischen Trend – ein Ansatzpunkt für eine Reflexion über die Nicht-Machbarkeit von Innovationen. Ich komme speziell darauf noch einmal zurück. Steht im vorherigen Zitat eher das natürliche Bild des Windes als Symbol für das Geisteswiren im Mittelpunkt, so berichtet die pfingstliche Erzählung sodann von „Zungen aus Feuer, die auf jeden herabkamen“.
Die Metaphorik verschiebt sich vom Haptischen und Akustischen ins Optische. Natürlich
geht es hier um das Feuer gläubiger „Begeisterung“. Feuer aber ist zugleich erleuchtend. Es macht hell. Und damit wird ein Begriffsfeld assoziiert, das in der abendländische Geistesgeschichte, wo immer es um Erkenntnis geht, von zentraler Bedeutung ist. Seit Platons berühmtem Sonnen- und Höhlengleichnis, ist das Erkennen als ein „geistiges Sehen“ verstanden worden. Das aber ist nur möglich in einem Licht, das immer schon da ist. Die spätere platonische, christlich transformierte Tradition spricht mit Augustinus und seinen geistigen Nachfahren von Illumination. Damit ist ein Doppeltes gemeint: sicher in erster Linie die Gotteserkenntnis, aber eben nicht nur diese, sondern schlichtweg jede geistige Erkenntnis ist ein Sehen und Sichtbarwerden der Dinge. Dieses Sehen ereignet sich im Wechselspiel von Aktion und Passion. Erfordert ist die aktive Bereitschaft.
Dennoch wird die Erkenntnis immer auch als ein Widerfahrnis betrachtet. Je tiefer eine Erkenntnis ist, desto tiefer kann diese Erfahrung reichen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für technische Erfindungen, deren Urheber nicht ohne Grund „Ingenieure“ genannt werden, Menschen also, die von einem „Genius“ getrieben werden. Hier bestände m.E.
ein hervorragender Ansatzpunkt für die christl. Religion, die wissenschaftl. „Begabung“ vorab zu dogmat. und moralischer Rechthaberei als eine Möglichkeit geistiger Begabung aufzufassen und theologisch zu würdigen. Umgekehrt sollten auch Wissenschaftler, wenn sie über ihr eigenes Tun nachdenken, zumindest bis zu dem Punkt kommen können zu verstehen, dass ihre Erkenntnisse nicht einfach nur von ihnen produziert werden, sondern ihnen oder vielleicht sogar durch sie der Menschheit „gegeben“ werden. Ein weit ausgreifender Gedankengang. Er könnte m.E. jedoch das Gespräch zwischen Wissenschaft und Religion wesentlich anregen und von den traditionellen „Kampffeldern“ in neue Gefilde führen (s. ausführlicher unter 3.)
Schließlich heißt es in der Apostelgeschichte, dass die Menschen, die den Geist erfahren haben, dies unmöglich für sich behalten können, sondern es in allen Sprachen weitersagen. Nun ist die Wissenschaft heute nur sehr bedingt polyglott. Im Gegenteil scheint eine bestimmte, leider oft schlechte Form des Englischen immer mehr den wissenschaftlichen Diskurs zu dominieren. Die Situation ähnelt damit in gewisser Weise dem Mittelalter und der Renaissance, in denen Verfallsformen des Lateinischen in der Wissenschaft üblich waren.
Aber ebenso wie die Glaubensgemeinschaft sich als ‚ecclesia ex omnibus gentibus’versteht, greift auch die wissenschaftliche Kommunikation über alle Grenzen der Sprache, des Geschlechts und der ethnischen sowie kulturellen Herkunft. Es geht um nichts geringeres als „universale Kommunikation“. Dies hat immerhin so renommierte Denker wie Jürgen Habermas dazu motiviert, die ’scientific community‘ in ihrer zwanglosen Kommunikation, in der nur das bessere Argument gilt, als Antizipation einer kommunikativen und erst so wirklich demokratischen, weltweit ausgreifenden Gesellschaft anzusehen. In dieser nach kommunikativen Prinzipien strukturierten Gesellschaft soll gerade nicht autoritäre Macht das letzte Wort haben, sondern kommunikative Vernunft herrschen. Das aber heißt prozedural, dass alle sich radikal der Logik der Argumentation unterwerfen und auch die Beendigung der Argumentation und die politische Entscheidung nur mittels eines Verfahrens erfolgen darf, das von allen akzeptiert werden kann. Mir scheint, dass diese im besten Sinne aufklärerische Vision einer von Vernunft beherrschten Welt eine hohe Parallelität, ja teilweise sogar Inhaltsgleichheit zu den endzeitlichen Visionen der jüdisch-christlichen Tradition aufweist.
Auch hier wird eine Welt antizipiert, in der Gerechtigkeit und Friede herrschen, weil Menschen bereit sind, im Angesicht Gottes eigene Ansprüche – auch Wahrheitsansprüche – zu relativieren und den anderen Menschen ebenso ernstzunehmen wie sich selbst. Gründe genug also, vertieft über die Analogien zwischen dem im Glauben überlieferten „Hl. Geist“ und dem „Geist der Wissenschaft“, in Anlehnung an ein Wort Montesquieus dem „ésprit de la science“, nachzudenken und diese beiden zentralen Erkenntnis- und Bewegkräfte des Menschen in einer Zeit überbordender globaler Probleme nicht ohne Not auseinanderzureißen, sondern gemeinsam für bessere Lösungen einzusetzen.
3. „Pneumatologie der Wissenschaft“?
Was sollte mit einer solchen Pneumatologie gemeint sein? Ist die Lehre vom Heiligen Geist nicht ohnehin ein theologisches Stiefkind geblieben? Ein Gebiet weniger für die seriöse Theologie als vielmehr für Schwärmer und Ketzer? Es lohnt sich innezuhalten und einen Moment nachzudenken, warum das so war. Bibeltheologisch würde man etwa darauf verweisen müssen, dass Vater und Sohn insgesamt wesentlich stärker biblisch fundiert sind, während sich für den personal verstandenen und in sich selbstständigen Heiligen Geist ungleich weniger Belege finden lassen. Dazu kommt, dass das Thema „Geist“ gegenüber dem Vater und dem Sohn nicht recht greifbar ist und das Schöpfen aus dem tiefen Brunnen der „Theorie der Geistes“ theologisch immer als verdächtig galt, weil der Heilige Geist ja gerade nicht identisch mit dem sein soll, was die philosophische Tradition unter „Geist“ fasst. M.E. wirkt an dieser Stelle genau jenes fatale und unproduktive Abgrenzungsbestreben nach, das den göttlichen, heiligen Geist und den menschlichen Geist, sei er subjektiv oder objektiv, nicht zusammenzudenken vermag. Dieses gerade in der heutigen Theologie manifest gewordene und unter Verweis auf den „Tod der Metaphysik“ gerechtfertigte „Geist-Verdikt“ wird nach meiner festen Überzeugung über kurz oder lang zu einer sterilen Theologie führen, die gerade nicht in der Lage sein wird, die geistig-kreativen Aufbrüche in den umgebenden Wissenschaften zu verstehen. Dort nämlich wird an kaum einem Thema mit so viel Lust und Intensität geforscht wie gerade an den geistigen Fähigkeiten des Menschen und ihrem Zusammenhang mit den materiellen Hirnstrukturen. An diesem Punkt steuern wir unweigerlich auf eine Neuauflage der Materie-Geist-Debatte zu, zu der die Theologie nichts wird beitragen können, wenn sie nicht schnellstens den Geist im weitesten Sinn – nicht nur den heiligen – rehabilitiert.Es geht mithin an dieser Stelle also nicht mehr nur um Analogien zwischen dem „Heiligen Geist“ und dem „Geist der Wissenschaft“. Es geht um ihre inhaltliche Beziehung.
Mir ist völlig bewusst, welch schwieriges Feld damit betreten wird. Die Wissenschaften selbst reflektieren eher selten über diese Beziehung. Die Philosophie verteidigt zwar in aller Regel die Nicht-Reduzierbarkeit des Geistigen, vor allem des ichhaften Selbstbewusstseins, mit immer neuen Varianten. Aber sie ist von einzelnen Vertretern wie Vittorio Hösle weit davon entfernt, einen umfassenden Begriff des Geistigen oder der geistigen Welt zu entwickeln, der überhaupt anschlussfähig an die Theologie wäre. Die „kritische“ Theologie – wie bereits erwähnt – rühmt sich, den „christlichen Platonismus“, das „hellenistische Erbe“, hinter sich gelassen zu haben. Dabei hat sie allenfalls eine wichtige Akzentsetzung korrigiert. Viel zu lange nämlich wurde die Theologie von „spiritualistischen“ Konzepten „regiert“, die keinen Bezug zum Leben der Menschen hatten. Der Glaube verstand sich als eine Art oberes Stockwerk des Erkennens. Man sprach seit dem Vordringen der „säkularen Wissenschaft“ von Glaubenswahrheiten als „übernatürlichen Wahrheiten“. Die damit einhergehende „Vergeistigung“ des Glaubens und der Theologie und ihre Missachtung des Körpers und der Seele wird von der neueren Theologie mit bestem Recht bekämpft. Aber auch ein ganzheitlicher, im Einklang von Körper, Seele und Geist gelebter Glaube, bleibt im weiteren Sinne ein geistiges Phänomen.
Es gibt gerade nach neueren Entwürfen der Anthropologie des früheren 20. Jahrhunderts nichts im Menschen, das nicht materiell ist. Es gibt aber ebenso auch nichts, was nicht einen geistigen Anteil hat. Der Mensch ist von Natur aus immer und durchgehend auch ein Kulturwesen. Er kann, seit er zum Bewusstsein seiner selbst erwacht gar nicht anders, als alle seine Akte geistig zu überformen und er erlebt sie eben deshalb tiefer. Dies gilt zunächst für die unmittelbar lebenserhaltenden Tätigkeiten wie Behausen, Ernährung und Fortpflanzung. Die Kulturgeschichte, soweit sie uns zugänglich ist, ist prall gefüllt von entsprechenden Belegen. Aber auch das, was wir im engeren Sinne als Kultur verstehen, ist Ausdruck geistiger Schöpferkraft, und damit auch die Technik und alle gesellschaftlichen Institutionen. Es gilt schließlich auch für die Sphäre, die Hegel mit dem überaus missverständlichen Begriff des „absoluten Geistes“ ansprach: Kunst, Wissenschaft/Philosophie und auch die Religion selbst. Hier kulminiert der ideelle Prozess. Die Welt wird sich selbst transparent, ein Vorgang, in dem wir zugleich Element und Beobachter sind. Ohne in diesem Zusammenhang das Hegelsche System adaptieren zu wollen, wird man doch mit dem o.g. Vittorio Hössle darauf hinweisen dürfen, dass ohne ein „ideelles Apriori“ dieser ganze Prozess unverständlich bleibt. Die Wissenschaft erscheint in diesem großen Zusammenhang als eine wesentliche Möglichkeit des Menschen, die in der umgebenden natürlichen und „kultürlichen“ Welt immer schon manifesten Ordnungsprinzipien zur Sprache zu bringen. Wollte man es „spirituell“ ausdrücken, dann ließe sich sagen, dass der Mensch/die Menschheit mittels seines/ihres Geistes dem in der Welt manifesten geistigen Prinzip auf die Spur kommt. Gleiches begegnet Gleichem. Aus dem Zusammenstimmen entsteht Erkenntnis.
Diese sehr kühne Deutung bedürfte einer eigenen Ausführung und soll an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden. Entscheidend ist für unseren Zusammenhang, dass (1) der geistige Prozess der Menschheit und das Wirken des „Heiligen Geistes“ notwendiger Weise desselben Ursprungs sind und (2) Wissenschaft ein Teil dieses geistigen Prozesses ist. Sie ist somit – zugespitzt formuliert – selbst ein spiritueller Vorgang.Die theologische Tradition scheint das immerhin geahnt zu haben, hat sie doch unter den sog. „sieben Gaben des Heiligen Geistes“ gleich mehrere aufgeführt, die einen deutlichen Bezug zur geistigen Tätigkeit aufweisen. Als Gaben werden genannt: Verstand, Wissenschaft, Weisheit, Rat, Frömmigkeit, Furcht (Gottes) und Stärke. Scheinen die letzteren drei stärker dem Handeln zugeordnet, so haben es die ersten vier mit Erkenntnis zu tun. Liest man jedoch nach, was die theologische Tradition hierzu ausführt (zur ersten Orientierung LTHK 4, S. 480), so wird dort ausdrücklicher Wert darauf gelegt, alle „geistigen Vermögen“ streng auf durch den Heiligen Geist gewirkten Glauben zu beziehen. So ist die dort gemeinte Wissenschaft genau nicht das, was wir gemeinhin darunter verstehen, sondern – einer Auslegung von Thomas von Aquin folgend – sind unter „Wissenschaft“ die Erleuchtungen zu verstehen, die uns mit einer gewissen instinktiven Sicherheit des Glaubensgut unterscheiden lassen von dem, was nicht zum Glauben gehört, das echt Kirchliche vom Unkirchlichen“. „Scientia“ erhält also, vom „Heiligen Geist“ in Dienst genommen, ebenfalls eine abgrenzende Funktion. Sie soll im Sinne der „Unterscheidung der Geister“ mithelfen zu beurteilen, wer noch im Raum im Glaubens ist und wer nicht (mehr). Auch hier also ist „scientia“ nicht mehr als die „ancilla“, die Magd. Eine eigenständige Funktion kommt ihr nicht zu.
Genau an der Stelle, wo systematisch die Gelegenheit bestünde, die Wissenschaft als Gabe des Heiligen Geistes anzusprechen, wird die Chance vertan. Man bedenke, dass es sich bei dem zitierten Lexikon um eine nachkonziliare Version handelt. Den Autoren oder jedenfalls den Herausgebern waren die Konzilstexte bekannt, namentlich die Würdigung des Eigenwerts der Wissenschaft in der bereits erwähnten Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ auf die sich auch Johannes Paul II. in „Fides et ratio“ ausdrücklich zustimmend bezogen hatte.Unsere Suche nach einem möglichen Ort der Wissenschaft im Rahmen der Pneumatologie endet also mit einem ernüchternden Ergebnis. Die theologische Tradition vermeidet es ausdrücklich, die Wissenschaft in diesem Zusammenhang positiv zu würdigen. Sie finalisiert sie vielmehr für ihr eigenes Erkenntnisinteresse. Es geht letztlich immer nur um das Eine: Glaube und Nicht-Glaube, Geistgewirktheit und Nicht-Geistgewirktheit voneinander zu unterscheiden. Schlicht formuliert: herauszufinden, wer zur kirchlichen Gemeinschaft gehört und wer nicht. Ein positives Interesse für Wissenschaft wird nicht erkennbar. Umgekehrt versteht man, warum die Pneumatologie in der Theologie immer ein „Mauerblümchen“ geblieben ist. Man fürchtete nicht ohne Grund die Wirkungen eines entfesselten Geistes. Dass gerade dieser entfesselte Geist grundlegend von Nöten ist, um unsere Welt – und übrigens auch die Kirche – voranzubringen, kann eine in Abwehrhaltung verharrende Theologie nicht erkennen. Sie müsste sich sonst eingestehen, dass ihre „Wahrheiten“ selbst ins Feuer der Kritik gezogen werden und auch revidierbar sein müssen. Eine Theologie, die diese produktive und nicht nur instrumentelle Begegnung mit der Wissenschaft riskiert, ist im wesentlichen ein Projekt der Zukunft.
Copyright © 2009 Naturwissenschaft und Glaube e.V.